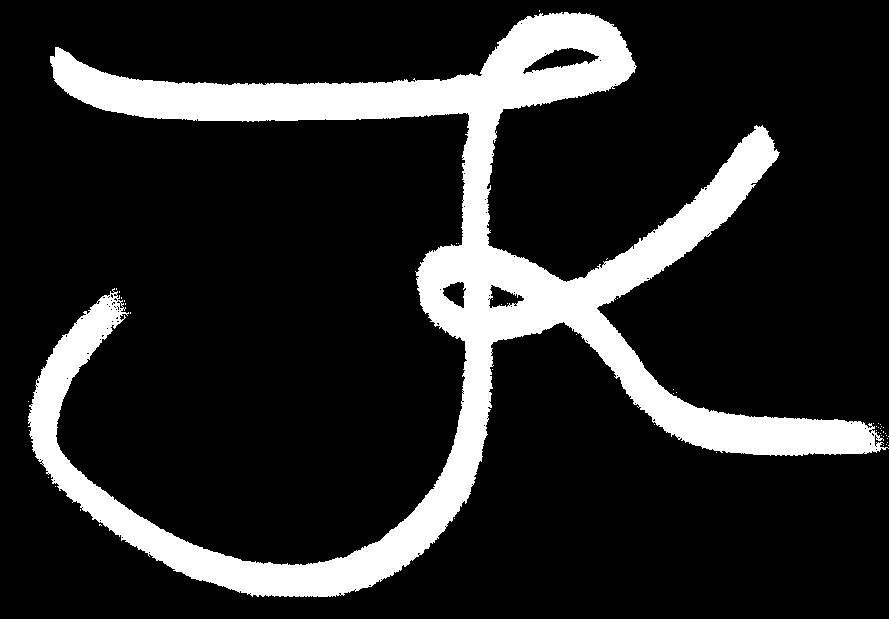Boris Godunow
Modest Mussorgski / Puschkin – Mussorgski
ML: Alexander Anissimov
R: Uwe E. Laufenberg
B: Christoph Schubiger
K: Jessica Karge
C: Peter Wodner
L: Franck Evin
Mit:
Mojca Erdmann, Martha Mödl, Caren van Oyen, Antigone Papoulkas,
Pavel Daniluk, Theo Adam, , Günter Neumann, Karsten Mewes, Andreas Conrad, Nikita Storojew, Peter Renz, , Christop Späth, Stefan Stoll, Klemens Slowioczek, Hans Martin Nau, Matthias Vieweg
Chor und Orchester der Komischen Oper Berlin
Komische Oper Berlin
P: 29.04.2001
Foto: © Komische Oper
Rezensionen als Link:
Rezension:
Billiger Russen-Pop hämmert aus dem Ghettoblaster, den der angeschmuddelte, debil dreinschauende Punk mit den feuerroten Haaren auf der Schulter trägt. Nein, wir sind nicht in Kreuzberg auf der revolutionären 1.Mai- Demo. Wir sind in der Komischen Oper. Die sich nach zweieinhalb pausenlosen Stunden „Boris Godunow“ (man spielt die Fassung von 1869) allerdings in eine Art Trainingscamp für potentielle Demonstranten verwandelt: Lauter, aggressiver schreit kein Autonomer. Weil es ein Sakrileg ist, die Oper in den Popsumpf zu treten? Weil Russland bei Regisseur Uwe Eric Laufenberg ganz wörtlich im Müll versinkt? Weil er eine Gegenwart auf die Bühne stellt, die tagtäglich unbequem über die Bildschirme flimmert?
Allein Jessica Karges Kostüme wirken so echt, als seien sie erst gestern in einem Moskauer Armenviertel geklaut worden. Doch Laufenberg setzt die U-Musik nicht als platte Provokation ein, sondern als Entsprechung für eine entscheidende Ebene in Mussorgskys Musik: das Volkstümliche, den Ton der Masse. (……..)
Der Chor singt prächtig und nutzt jede Chance, aus der Masse individuelle Charaktere zu formen, das Orchester spielt unter der Leitung Alexander Anissimov so nuancenreich und gut wie lange nicht mehr.
Laufenbergs genau beobachteter, differenziert entwickelter „Boris“ ist Balsam nach den letzten, gründlich missglückten Premieren der Komischen Oper. Auch wenn der ganze Zuschauerraum für die nächste Straßenschlacht übt.
Die Welt, 02.05.01
Wenn der Gottesnarr ( Christoph Späth) im vorletzten Bild seinen bitteren Abgesang auf Volk und Zar anstimmt, wendet er ins Hörbare, was er zuvor als omnipräsenter stummer Statist mehrfach schon sichtbar gemacht hatte: die unaufhaltsame Deklassierung der Ärmsten der Ärmsten. Sein Striptease im Schneegestöber zwischen weißen Birkenstämmen wirkte wie ein absurd- schönes Bild für die Sehnsucht nach besserem. Ein Schock der Erkenntnis auch die Poesie des Mülls, der da mit einem Male aus dem Schnürboden fiel und von Volk und Narr hoffnungsvoll durchstöbert wurde. In dem Rascheln, welches Mussorgskys von einfachen Trauersekunden durchwebte Musik grundierte, verwandelte sich unterderhand ein altes Schimpfwort zu einem Schlüsselbegriff: „Mussor“ (das heißt „Müll“ oder „Schutt“) hatte man nach der Uraufführung des „Boris“ in der Petersburger Presse gehöhnt, in Anspielung auf den Namen des Komponisten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.05.01
The KOMISCHE OPER has a new Boris and it’s a stunner: a radical, daring and, in its own terms, wholly valid ‚go‘ at the problematic masterpiece, which does the house’s reputation no end of good. What, then, are ‚its own terms‘? Firstly, the Ur-1869 version, in seven scenes, given without a break. The dramatic effect of this alone is considerable. This is certainly not a production that sprawls, rather one that assaults. Parallel to this is producer Uwe Eric Laufenberg’s determination to strip away any notion of a gilded, picture-book past-thank God, no cupolas and pretty cloisters here. He does not actualize the setting so much as continually suffuse past and present into each other, so that various forms of dictatorship and oppression, along with occasional moments of hope or thaw, are blended together, largely by virtue of newsreel film. Nonetheless, the poverty and misery of the people are very much of today. Their miserable rags, the faded gentility of once-good clothes, their plastic shopping bags, their status as beggars and scavengers is in your face. You can imagine how a well-dressed first-night audience (April 29) felt when confronted by this. With Boris, Laufenberg employs stage techniques quite different from his dazzling and homogeneous Ariadne auf Naxos of last season. Now he (and his brilliant designer Christoph Schubiger) are keen to dislocate, to confront us with a variety of images, whether a rubbish-dump thrown contemptuously down onto the stage from the flies, or a tiny but highly realistic inn for Varlaam’s scene, or an exquisite birch forest bathed in snow evoking an unsullied world. But throughout it all the shoddy machinations of power and their dreadful consequences for a people not in control of their own destiny is never off the stage.
Still, the ‚people‘ have centre stage in this production so it’s good to record another triumph for the Komische Oper chorus, probably the best of the three in Berlin at the moment. These people know what it means to act. They are used to being a major dramatic factor in productions and their stage skills are unequalled in the capital.
This was a remarkable and serious Boris; the bellowing discomfort of the first-night audience (they don’t really mind reality on the stage as long as it’s pretty- bless them) was essentially a vindication of the Komische Oper’s success in presenting fresh and splendid operatic theatre.
Opera, August 01
The Kremlin is, after all, only a train-ride away from the Brandenburg Gate. Russia`s tragedies are uncomfortunaly close to home, more today than ever before. As the country disintegrates, berlin catches the fall-out- the rich in its exclusive boutiques, the poor in illegal jobs on its countless biulding sites…
This month would have been the 100th birthday of Walter Felsenstein, the director who revolutionised music theatre at the Komische Oper during his long term at its head (1947-1975). A lively and immediate Boris Godunow so much better than most of the house`s recent premieres is a good way to honour the occasion.(…) If the production is too busy, as though the music cannot be trusted to hold the audience`s interest, there`s compensation in the fact that the acting is superb, and the chorus work breathtaking. Despite bemusing moments, the staging is intellectually strong and technically expert, with flashes of genius.
Financial Times, 07.05.01
„Boris Godunow“ an der Komischen Oper
Wir sehen einen Mann in der Blüte seiner Macht. Zerrissen, zerquält durch Selbstvorwürfe. Durch Mord am Thronfolger gelangte dieser Zar Boris einst an die Macht. Und diese Schuld wiegt schwerer als das Gute, das er tut. Boris selbst wird Opfer, Spielball der Geschichte. Eine große russische Volksoper hat sich die Komische Oper da vorgenommen: Modest Mussorgskis „Boris Godunow“, in der schlanken Urfassung von 1869 inszeniert von Uwe-Eric Laufenberg („Berlin Alexanderplatz“). Der Ukrainer Pavel Daniluk singt den Boris – auf Deutsch, in bester Felsenstein-Tradition, sehr expressiv, dem Tod wollte er so gar nicht ins Auge sehen. Große Namen an seiner Seite: Martha Mödl als Amme, Wagner-Star Theo Adam als greiser Verkünder Pimen. Beide heftigst bejubelt. Doch der wahre Held dieser Oper ist der Chor, der das schlimme russische Leiden aus Jahrhunderten mit voller Wucht auf die Bühne bringt. Dass Regisseur Laufenberg Müll auf die Bühne wirft und das Haus mit dröhnenden Pop-Rhythmen „entweiht“, nahm man ihm sehr übel. Solche Buhs hat man hier noch nicht gehört. kam
Kultur Komische Oper Berlin:
Ich liebe euch doch alle
von Ulrich Amling
Fassungslos steht ein reiferes Opernenthusiastenpaar aus London im Strom des abwandernden Premierenpublikums. Soeben haben die beiden erlebt, wie „Boris Godunow“-Regisseur Uwe Eric Laufenberg vom Publikum der Komischen Oper auf offener Bühne mit einer Buh-Salve niedergestreckt wurde. „Ich habe selten eine Inszenierung gesehen, die so stark gespielt war und so voller Ideen“, sagt der Mann verwundert. „Und in London kosten vergleichbare Tickets drei mal mehr“, fügt die Frau hinzu.
Es ist nicht zu überhören an diesem Abend: Der wutschnaubende Protest gegen Inszenierungen, die versuchen, sich aus der Ausstattungsecke heraus zu manövrieren, hat nun auch das einstige erste Dulder-Haus am Platz erreicht. Hier wusste das Publikum schon immer, das nicht alles Gold ist, was glänzt, sondern meistens Kupfer. Geklatscht wurde trotzdem. Nun waltet auch an der Komischen Oper der Ungeist, den die Berliner Opernkrise auf den Plan rief und fordert: „Weg mit dem Regietheater!“ Eine Demonstration, kurz vor dem 1. Mai.
Bei genauerem Hinsehen jedoch erntet Laufenbergs „Boris“ nichts anderes als den Fruststurm, den er selbst gesät hatte. Dabei ist die Leistung seiner Arbeit nicht von der Hand zu weisen. Zuallererst: Die mutige Entscheidung für Modest Mussorgskis Urfassung von 1869, die mit ihrer fast filmischen Dramaturgie in nur wenigen Szenen die Grundkonflikte von hungerndem Volk und fallendem Zar einfängt. Pausenlos in gut zwei Stunden auf die Bühne gestemmt, glimmt die kühne Konzeption des Komponisten intensiv und dunkel auf. Der später hinzukomponierte „Polen-Akt“, der eine große Sopran-Partie ins Spiel brachte und jenen Grigori, der als „falscher Dimitri“ auf den Zarenthron drängt, zu einer wirklich menschlichen Gestalt formte, fehlt – und man vermisst ihn nicht. Auch ist Laufenbergs Idee, die blutige Erbfolge, die um 1600 in Russland tobte, in die heutige Zeit zu versetzen, direkt aus dem „Boris“ destilliert. Sowohl Puschkin, der mit seinem Drama die Vorlage lieferte, als auch Mussorgski kommentierten mit ätzender Schärfe die Entwicklungen ihrer Gegenwart. Ein Historienschinken war „Boris Godunow“nie.
Doch wie bis zur Gegenwart vordringen, wie das auf die Bühne bringen, was früher nur „eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Sowjetunion“ hieß. Mussorgski kannte seinen Königsweg: „Das Volk allein ist unverfälscht, groß und ohne Tünche und Flitter.“, schrieb er. Damit hatte er sich zu einem Liebesbekenntnis für die manipulierbare Masse durchgerungen, das weit über Puschkins spottende, den Pöbel verachtende Sicht hinaus ging. Uwe Eric Laufenberg landet irgendwo dazwischen, was vielleicht auch daran liegt, das ein ganzer Opernchor für einen Regisseur nur schwer zu lieben ist. So gewinnt das Volk in einer einzigen Szene wirklich Größe: Wenn es auf einer Müllhalde stochernd den kommenden Herrscher ersehnt, in der diffusen Hoffnung, das es nur noch bergauf gehen kann. Als Boris (Pavel Daniluk) an seinen darbenden Untertanen vorüber geht, greift er instinktiv in seine Manteltaschen. Doch als Zar trägt man keine Geldbörse bei sich. Traurig stapft der Herrscher weiter. Diesen kleinen Szenen im Binnengeflecht der Figuren ringt der Schauspielregisseur Laufenberg durchaus Kraft ab.
Doch leider versinkt alles nach und nach im Sumpf halbgarer Russland-Bilder, die statt aktueller Zuspitzung nur zu geschichtlicher Unschärfe führen. Dass Bilder vom deutschen Überfall auf die Sowjetunion und die Staatskrisen unter Gorbatschow per Video verschnitten werden und zusammen soßig von einer riesigen Leinwand tropfen, ist nichts als dumm. Und wenn nach einer wodka-marinierten Wirthausszene Maschinengewehrfeuer durchs Grenzgebiet dröhnt, ist wahrscheinlich nur ein Tontechniker wild geworden. Hier wird nicht zuviel gewagt, sondern schlicht zuwenig gedacht.
Trotzdem sollte man sich diesem „Boris Godunow“ musikalisch nicht entgehen lassen. Ohne der glatten Pracht von Rimsky Korsakows Bearbeitung auch nur eine Minute nachzutrauern, entdeckt Alexander Anissimov mit dem Orchester der Komischen Oper das Schroffe, Erdige wie auch das lyrische Potential der Partitur. Ein erstklassiger Begleiter mit kammermusikalischem Gehör. Pavel Daniluk verleiht seinem Boris durchaus liebevolle Züge, deklamiert aber zuviel, um als Sänger restlos zu überzeugen. Genau anders herum verhält es sich bei Theo Adams Pimen, der zu viel vergangenen Schmelz beweisen will. Martha Mödl schließlich verwandelt die Amme in ein Gespenst von furchterregender Präsenz. In ihren großen Greisinnenaugen gewinnt das Leiden, das Aufbegehren, das Menschliche endlich eine glaubwürdige Gestalt.