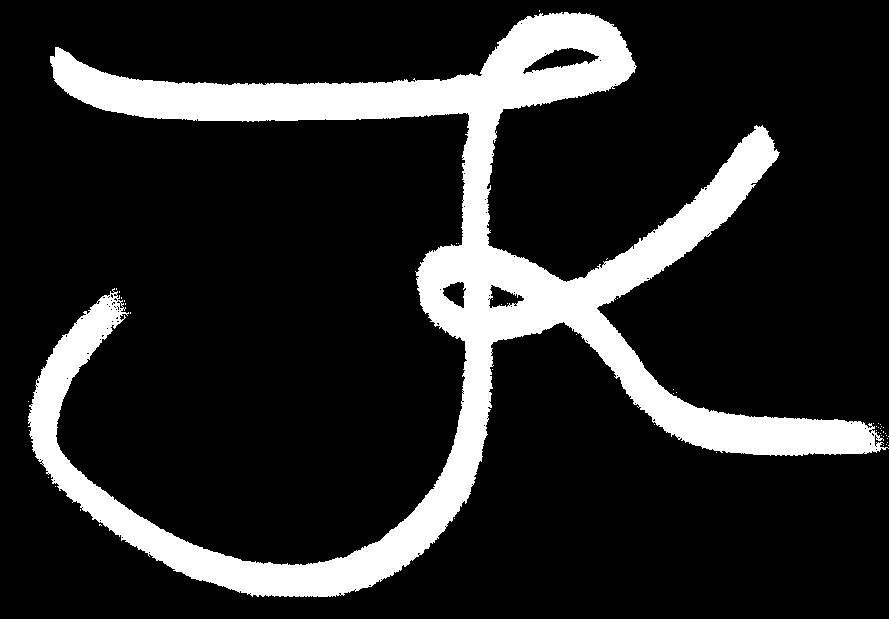Der Prinz von Homburg (Hagen Bähr) sieht seiner Exekution durch von der Golz (Sven Zinkan) entgegen. Prinzessin Natalie (Meret Engelhardt, hinten, v.l.), der Kurfürst (Hans-Joachim Rodewald), Graf Hohenzollern (Björn Boresch) und Dörfling (Michael Jeske) sind Zeugen. Foto: ed
Meiningen. Das Meininger Theater hat seiner aktuellen Spielzeit das zeitlos verdienstvolle Motto „Nie wieder Krieg!“ gegeben. In seiner Regiearbeit zum Thema klammert Intendant Ansgar Haag zwei Stücke zusammen: Kleists „Prinz Friedrich von Homburg“ mit der Schlacht von Fehrbellin, dem Gründungsmythos Preußens, und Borcherts „Draußen vor der Tür“, da war Preußen endgültig untergegangen und verbrannt.
Verbindendes hätten die beiden Stücke schon. Aber nicht gerade das, was die Meininger Theaterzeitung „Spektakel“ behauptet: Hier ist von „den beiden Antikriegsdramen“ die Rede. Für den „Prinzen von Homburg“ kann man sicherlich einige Etikettierungen finden, aber ein Antikriegsdrama ist er nun wirklich nicht. Und das ist wohl der Hauptgrund dafür, warum Kleists träumender Prinz und Borcherts traumatisierter Veteran Beckmann schlechter zueinander passen, als Haag es gern hätte.

Michael Jeske spielt den Beerdigungsunternehmer in „Draußen vor der Tür“.
Alles steht schief im Lande Brandenburg, wie Bühnenbildnerin Kerstin Jacobssen es auf die Meininger Bühne baut: Alle Akteure müssen ständig eine schräge Ebene hinauf und hinunter. Das kommt dem jungen, sehr jungen Prinzen Friedrich Arthur von Homburg entgegen, den Hagen Bähr mit einer fast penetranten kindlichen Begeisterungsfähigkeit und Rastlosigkeit ausstattet und der ein paarmal zu oft über seine eigenen Füße oder seinen Lorbeerkranz stolpert; fehlt nur noch, dass er sich mit Hurra die Schräge hinunterkugelt. Welcher Kurfürst, fragt man sich, überließe einem solchen Kindskopf einen kriegsentscheidenden Truppenteil?
Hagen Bähr darf den Prinzen herrlich komödiantisch spielen. Dass dieser Homburg sich von einem Handschuh dermaßen ablenken lässt, dass er seinen Tagesbefehl überhört, wundert niemanden; dass er selbst im Angesicht seiner nahenden Hinrichtung noch ganz das arrogante Söhnchen aus besserem Hause gibt, ebensowenig.
Aber weil ihm Nachdenklichkeit und Selbstreflexion so offensichtlich abgehen, kommt sein Sinneswandel gegenüber dem Todesurteil – vom unehrenhaften Flehen um Gnade zur erhabenen Akzeptanz des Unvermeidlichen – doch sehr abrupt. Wollte man den „Prinzen Friedrich von Homburg“ als Coming-of-Age-Drama verstehen, täte er in der Meininger Inszenierung einen allzu unvermittelten Entwicklungssprung.
Umso wichtiger sind die konstanten Charaktere, vor allem Prinzessin Natalie, die Meret Engelhardt als wahrhaft aufopferungsvolle Seele spielt, oder der Kurfürst (Hans-Joachim Rodewald), der sich in seiner preußisch strengen Pflichtauffassung eben doch erweichen lässt, wenn ihm die Menschlichkeit dazwischenkommt. Beide werden im kurzen Borchert-Teil des Abends wieder auftauchen, beide werden zu Zeugen dafür, dass im 20. Jahrhundert alles viel schlimmer ist: Das Mädchen in „Draußen vor der Tür“ ist so fürsorglich und liebevoll wie Homburgs Natalie, hat aber nicht mehr die Kraft, den Lebensmüden zu retten; der Oberst hat seine preußischen Tugenden über Bord geworfen, seine Menschlichkeit sowieso, und ist nur noch zynischer Kriegsgewinnler. Wie Rodewald den krassen Unterschied zwischen Kurfürst und Oberst herausspielt, das ist fabelhaft.
Für eine halbe Stunde Borchert steckt Kostümbildnerin Jessica Karge Kleists Obristen und Rittmeister noch schnell in Kostüme wie aus einem George-Grosz-Gemälde: den Bestattungsunternehmer mit Zigarre (Michael Jeske) oder den untoten „Anderen“ (Björn Boresch), der nur auf Tode zu warten scheint. Aber der Betrachter wird das Gefühl nicht los, dass der Abend stärker gewesen wäre ohne den harten Übergang von Kleist zu Borchert.
Eine Antikriegs-Lehre lässt sich aus Kleists Drama auch ohne Borchert-Epilog ziehen. Beide Stücke zu einem kontinuierlichen Antikriegs-Abend zu verschmelzen – so als sei Prinz Friedrich im 17. Jahrhundert zum Preußenkämpfer fanatisiert worden und müsse 1945 die Folgen ausbaden –, das funktioniert nicht, das ist so unangemessen begütigend, wie Antonia Derings melancholisch-jazzige Bühnenmusik in manchen Szenen klingt. Und es wird keinem der beiden Stücke gerecht.
Dass Hagen Bähr beide spielen kann, Homburg und Beckmann – wenn auch den einen etwas zu kindlich und den anderen etwas zu hysterisch –, das hat er bewiesen. Zu gönnen wäre es beiden Rollen, sie hätten einen ganzen Abend Zeit, sich zu entwickeln. Dann bräuchte es sicher auch den arg pädagogischen Epilog im Zuschauerraum nicht: Da wandert Bähr/Beckmann durch eine Reihe im Parkett und fordert vom Publikum Antworten auf seine rhetorischen Fragen. Gegenfrage: Soll uns das mehr beeindrucken als der ganze Kleist? Oder einfach: Muss das sein?
Und trotzdem: Dieser Abend tut gut. Nicht, weil er das Bedürfnis nach Antikriegs-Floskeln befriedigt; sondern weil er daran erinnert, dass Krieg nie die richtigen Antworten gibt.
Frauke Adrians / 02.12.15 / TLZ